Carey Fukunaga ist einer meiner Lieblingsregisseure. Und einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist die Verfilmung von Charlotte Brontës Jane Eyre.
Obwohl die Sprache des 19. Jahrhundert leidenschaftlich, blumig, ausladend und emotional ist, hat Jane Eyre eine nüchterne Düsternis und kühle Klarheit, die mich immer wieder fasziniert. In Fukunagas Film stapft Jane durch dunstige Moore, über eiskalte Steinböden und durch strömenden Regen. Schweigend. Stoisch. Aufgewühlt und stumm. Viel von dem, was Jane bewegt, passiert, wenn andere reden.
Jane ist ein Waisenkind und wächst in der Familie ihres Onkels auf. Sie ist ein seltsames Kind, irgendwie aufmüpfig und wiederborstig. Findet zumindest die Witwe ihres Onkels. Jane wird gehänselt, misshandelt und schließlich in eine Internat für Mädchen abgeschoben. Dort freundet sie sich mit einem Mädchen an, dass irgendwann stirbt. Jane steht auf Stühlen, kriegt was auf die Finger, ist, immer noch ein Außenseiter.
Wenn alle anderen Mädchen essen gehen, muss sie Strafen absitzen. Wenn alle anderen Mädchen plaudern, muss sie schweigen.
Jane wird zu einem Mauerfleck. Nur da, wenn man sie sehen will. Ansonsten störend oder unbeachtet. Aber sie ist da. Sieht, was geschieht, hört, was gesprochen sieht. Nicht selten sind Menschen, die systematisch ausgeschlossen werden, deren Existenz davon abhängt, die Launen anderer zu lesen, gute Beobachter. Jane wird zu einer jungen Frau, die dafür bereit ist, etwas zu entdecken. Sie weiß es nicht, aber sie hat die Fähigkeit Geheimnisse zu lüften.
Was geht in uns vor, wenn wir nicht sprechen? Man kann nicht kommunizieren und das wird besonders deutlich, wenn keine Worte fallen. Jane ist lebendig, aufmerksam, glüht. Stumm. In Mr. Rochesters Haus gehen seltsame Dinge vor, aber wenn sie ihm gegenüber sitzt, verschlingt sie seine Anwesenheit. Hungernd nach dem düsteren Blick, Bemerkungen. Er sitzt auf einem schwarzen Pferd, Jane steht im Laub.
Die brodelnden Gefühle einer Gothic Romance sind nicht leicht, realistisch zu machen. Was beim Lesen langsam einen Strudel erzeugt, kann mit dem bloßen Auge schnell als albernes Getue abgetan werden. Aber Mia Wasikowska spielt so elegant, so minimalistisch und tiefgründig, dass ihre Jane immer glaubwürdig bleibt. Ohne durchsichtig zu sein. Wir denken mit ihr, nicht über sie. Wir fühlen mit ihr, nicht an ihr vorbei.
Sie spricht, wenn es zu sprechen gilt. Nicht aus bloßer Langeweile oder Bequemlichkeit.
Die Worte dringen durch die Stirn und an die Oberfläche, als wäre der Prozess des Sprechens, des sich Öffnen und Offenbaren zu lange unterdrückt gewesen. Dass Jane Gefühle behält, die sie bewegen, ist eine Kraftanstrengung, die an ihr zehrt. Sie liebt. Aber es kostet etwas.
Und Rochester kann ihr nicht geben, was fehlt.
Müssen wir sprechen? Zwillinge sprechen oft später, weil sie eine innige Verbindung zu ihrem Geschwisterkind haben, die verbale Kommunikation unnötig macht. Du bist da. Wir sind gemeinsam.
Eine Berührung, zwei zuckende Pupillen, ein Laut hinter der Tapete. Jane hört, auch wenn nichts gesagt wird. Sie wurde systematisch stumm gemacht. Aber langsam wühlt etwas in ihr, das nach Ruhe schreit. Die schlammbespritzten Stiefel zerren an den rennenden Beinen, der Mantel schon wieder klatschnass gegen den Wind gestemmt. Die Wiese schleudert ihr Regen entgegen, und als sie auf der Türschwelle des Pfarrers zusammenklappt, knuspert schon das Fieber an ihren Hacken.
Endlich. Ruhe. Vor dem Kamin. Zarte Striche auf dem Papier. Oh Jane, sie malen so schön. Der Blick schweift immer noch nach draußen. Durch die kleinen Fenster und weiter im weißen Dunst, bis zu einem Ort, an dem sie ihn vermutet. Rochester. Immer noch. Aufgewühlt.
Es ist ein fast unwiderstehlicher Drang, Natur zu erleben, wenn wir nach Ruhe suchen. Irgendetwas an der Art, wie die Wellen gegen Felsenklippen klatschen und der Mond seine Bahnen zieht, beruhigt und tröstet uns. Spendet Komfort und neue Lebenskraft. In Jane Eyre ist die Natur nicht nur ein eigener Charakter, alle Menschen in der Geschichte sind – Natur. Janes Gefühle stürmen mit dem Wind, Hitze prasselt über die Wangen, wie das Feuer im Kamin. Wenn der Nebel aufsteigt, dann mit ihm die Ahnungen. Fällt Regen rollt eine Träne.
Die Art und Weise, mit der Carey Fukunaga Natur in Szene setzt, macht Jane Eyre für mich zu einem ganz besonderen Film. Denn wenig Filmemacher schaffen es, Morgentau an den Zuschauer heranzutragen. Den zarten Duft von Blüten, die im Wind wehen oder den warmen Dunst aus dem Nadelwald. Fukunagas Kameraarbeit lässt einen immer in die natürliche Welt der Geschichte eintauchen, wirklich fühlen, was in ihr vor sich geht. Nimmt einen mit, in den Organismus, in dem alle Charaktere leben.
Dafür, da bin ich mir sicher, braucht man Ruhe. Die Fähigkeit still und aufmerksam zu sein. Auf sich wirken zu lassen und sich als Teil von allem, was einen umgibt, wahrzunehmen. Die Ruhe zu haben, hinzusehen, hinzufühlen und wiederzugeben, was geschieht. Carey Fukunaga erzählt Geschichten wie einer, der zusieht. Genau wie Brontë. Und das macht ihn für mich zu einem perfekten Filmemacher für Jane Eyre.
Die Zeit steht nicht still, so, wie ein Herz nicht aufhört zu schlagen. Gedanken kreisen und Häuser gehen in Flammen auf. Janes Reise ist eine Suche nach Ruhe. Nach der Art von Ruhe, die nur durch Liebe ausgelöst werden kann. Deswegen steht sie rastlos, schon wieder vor einer Ruine. Aber diesmal kann er ihr geben, wonach sie gesucht hat. Ruhe. Eine Hand, die die andere berührt. Warme Weste gegen das pochende Herz. Zuletzt wetzt das Leben aus der größten Unsicherheit die schönste Kraft. Und Jane findet genau dort, wo sie am Unglücklichsten war, die größte Erfüllung.
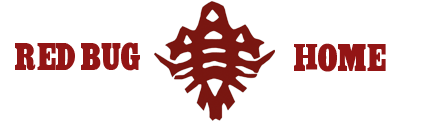






No Comments